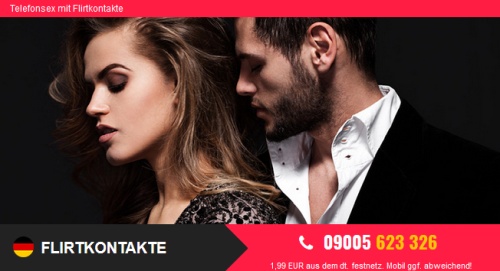Wieso ausgerechnet ich? Wieso immer ausgerechnet ich? Bin ich etwa der persönliche Hanswurst meines Chefs? Ja, ganz offensichtlich. Jedenfalls bin ich für jeden Scheiß zuständig, zu dem er keine Lust hat. Er hat zu sehr viel keine Lust, und meistens sind es natürlich die unangenehmen Dinge. Er könnte mir ja auch mal ein paar angenehme Dinge abtreten. Mir ein paar Theaterkarten zu einem Stück geben, in dem ein Klient von uns auftritt, die er uns geschenkt hat, damit ich mir das Stück ansehen kann. Mich zum schicken Abendessen mit einem Kollegen gehen lassen, bei dem man sich über einen möglichen Vergleich unterhält, um einen Rechtsstreit zu vermeiden. Mich zu den einfachen Terminen gehen lassen, wo man nur die Anträge stellen muss und den Rest macht das Gericht. Mir die einfachen Fälle geben.
Aber nein – statt dessen bekomme ich immer die Akten, die aus mehreren dicken Leitz-Ordnern bestehen, wo manchmal die Frist schon versäumt ist, statt dessen bekomme ich die Termine, wo man einen ganzen Nachmittag einer Zeugenbefragung oder einer Sachverständigenerörterung opfern muss und trotzdem noch sehen, wie man abends noch ein paar Mandanten empfängt und die Arbeit erledigt, die bis zum nächsten Tag getan sein muss. Und ich bin diejenige, die seinen Porsche zur Inspektion bringen muss, während der Arbeitszeit, und wenn ich dann zwei Stunden später damit zurück bin – nicht dass es nicht Spaß machen würde, Porsche zu fahren -, dann erwartet mich ein ganzer Stapel Telefonnotizen und es sitzen nicht nur meine Klienten im Wartezimmer, ungeduldig, weil ich mich verspätet habe, sondern auch noch zwei von seinen, die er einfach keine Lust hat zu sehen. Er herrscht in unserer Kanzlei wie ein Despot – und ich mache es mit. Ich brauche nämlich das Geld. Mein Ex-Mann hat Schulden gemacht, für die ich selbstverständlich mit unterschrieben habe. Und da er keinen Cent verdient, darf ich sie dafür jetzt ganz alleine abzahlen. Und Unterhalt an ihn noch dazu. Würde ich meine Stelle in der Anwaltskanzlei aufgeben, würde er mich auf fiktiven Unterhalt verklagen, das hat er schon gesagt, denn schließlich bin ich dazu verpflichtet zu arbeiten (und was ist mit ihm???) und darf nichts tun, was meinen Job gefährdet.
So kommt es auch, dass ich an einem Samstag Morgen, an einem freien Wochenende, unterwegs bin nach Frankfurt zum Flughafen, um einen Freund meines Chefs abzuholen, der aus Amerika zu Besuch kommt. Er hat mal wieder – na, ratet mal? Genau, keine Lust. Er will nicht so früh aufstehen, er will die lange Fahrt nicht machen, also muss ich ran. Natürlich könnte ich mich weigern. Ich bin Angestellte, kein Sozius. Und von „Freude des Arbeitgebers vom Flughafen abholen“ und ähnlichen Dingen steht kein Wort in meinem Arbeitsvertrag. Ich bin hier als Anwältin, nicht als Dienstmädchen. Aber was würde mir das bringen? Entweder schmeißt er mich gleich ganz raus, oder er macht mir nächste Woche die Arbeit zur Hölle. Noch mehr als ohnehin schon, meine ich jetzt. Nein, ich habe schön brav zugestimmt und ihm versprochen, ihm seinen Freund pünktlich zum Frühstück in seinem Privat Haus abzuliefern. Deshalb bin ich um sechs aufgestanden, habe mich schnell fertig gemacht – ohne mir allzu große Mühe mit Make-up oder mit meiner Kleidung zu geben, denn schließlich bin ich ja nur der Chauffeur und nicht mehr, und stehe nun anderthalb Stunden später in einer Halle, in der es von Menschen nur so wimmelt, ein Schild in der Hand, auf dem mit großen Buchstaben der Name meines Chefs steht.
Ich habe keine Ahnung, wer gleich, wenn die Flut von innen sich mit der Flut von außen vermischt, auf mich zukommen wird. Ich weiß seinen Namen, Robert Brown, aber mehr auch schon nicht. Ich weiß nicht, ob er groß oder klein ist, dick oder dünn, jung oder alt. Ich weiß nur, wenn er ein Freund von meinem Chef ist, werde ich ihn ganz bestimmt nicht mögen. Ohne großes Interesse betrachte ich mir die Menschenmassen. Auf dem Flug waren auch ein paar Afroamerikaner. Sie fallen einfach auf. In Deutschland gibt es nun einmal nicht so viele Schwarze. Außerdem, bilde ich mir das ein, oder haben die Afroamerikaner tatsächlich eine ganz besondere Art, sich zu bewegen, so, nun ja, graziös ist das erste Wort, das mir als Beschreibung dazu einfällt, aber das trifft es nicht so ganz, denn irgendwie ist graziös ein weibliches Adjektiv, und die schwarzen Männer bewegen sich ähnlich, ohne deswegen im geringsten weiblich zu wirken.
Ach, ist mir doch auch egal, was das richtige Adjektiv wäre. Ich stehe hier mit meinem blöden Schild und warte. Trotzdem kann ich nicht umhin, einen dieser Schwarzen immer wieder anzustarren. Er besitzt einfach eine solch starke Ausstrahlung. Selbst über die Distanz hinweg, mitten im Strom anderer Menschen, die gegen seine dunkle Haut alle blass wirken. Er hat meinen Blick bemerkt, erwidert ihn. Oder war es anders, hat mich sein Blick zu mir auf ihn aufmerksam gemacht? Er lächelt mich an. Es ist wie ein Geschenk. Mir wird ganz warm, und ich denke, allein schon wegen dieses Lächelns hat es sich gelohnt, so früh aufzustehen. Leider wird man kleiner Interracial Flirt nicht lange dauern; gleich wird er sich an mir vorbei schieben und zum Ausgang gehen. Schade. Doch von wegen – er kommt direkt auf mich zu. Oh Gott! Findet er mich etwa interessant? Interessant genug, mich anzusprechen? Mein Herz klopft. Tatsächlich, er bleibt direkt vor mir stehen. „Sie kommen für Mr Stetten?„, fragt er mich, mit einem amerikanischen Akzent, aber in einwandfreiem Deutsch.
Ich muss schlucken. Die Enttäuschung reicht tief. Nein, dieser Afroamerikaner fand nicht mich interessant, sondern nur mein Schild, und er hat auch nicht mich angelächelt, sondern nur erleichtert in sich hineingelächelt, weil er in dem Gewimmel die Person entdeckt hatte, die ihn abholen soll. Ich bejahe, begrüße ihn in Deutschland und frage ihn, wie sein Flug war; natürlich alles auf Englisch. Das ist ja einer der Gründe, warum mein Chef mich geschickt hat; mein Englisch ist recht gut und auf jeden Fall besser als seines. Bisher hatte ich mich immer gefragt, wie die beiden sich denn bloß verständigen, er und sein Freund aus Amerika, von dem er mir ja auch mal hätte sagen können, dass es ein Schwarzer ist, dann wäre ich wenigstens vorbereitet gewesen. Jetzt vermute ich, dieser Mr Brown spricht Deutsch mit ihm.
Mir antwortet er allerdings auf Englisch, und streckt mir die Hand hin. Unbeholfen stelle ich das dämliche Schild beiseite, nehme sie. Klein und zierlich und hell ruht meine Hand in seiner großen dunklen. Es sieht seltsam aus. Und die seltsamsten Gedanken gehen mir durch den Kopf, als wir durch den Flughafen zur Tiefgarage marschieren, wo ich mein Auto abgestellt habe, einsteigen, losfahren. Ich komme mir vor wie ein Rassist, dass ich so extrem auf seine schwarze Hautfarbe reagiere. Okay, wie ein positiver Rassist, denn er gefällt mir, dieser Afroamerikaner. Aber Rassismus ist Rassismus; jede Reaktion, die bei weißer, grüner, gelber Haut anders wäre als bei schwarzer ist Rassismus. Auch wenn es eine positive ist. Vielleicht ist die sogar noch viel schlimmer. Die Schwarzen wollten die Gleichberechtigung und haben sie weit gehend bekommen. Was sie garantiert nicht brauchen, das sind weiße Girls, die sie nur wegen ihrer schwarzen Haut anhimmeln. Um zu verbergen, was ich denke, und vor allem, wie nervös er mich macht, zeige ich in Sprache und Körpersprache deutliche Distanz zu Brown. Er ist für mich nur ein Mann wie jeder andere, und zwar einer, den es mir eine lästige Aufgabe ist, ihn vom Flughafen abzuholen. Daran darf sich nicht dadurch etwas ändern, dass er schwarz ist. Gleichberechtigung bedeutet, gleich behandelt werden wie ein Weißer. Und da es Samstagmorgen ist und ich hier so sinnlos unterwegs bin, statt gemütlich in meinem warmen Bettchen zu liegen und mich auszuschlafen, bin ich muffelig; ob derjenige, den ich abhole, nun Schwarz oder Weiß ist.
Aber Moment mal – wenn der Weiße, den ich abholen sollte, ebenfalls gut aussehend und nett wäre, dann würde ich doch auch versuchen, mit ihm zu flirten, oder etwa nicht? Dann darf ich auch mit diesem Brown flirten, der mir wirklich gut gefällt. Mir brummt der Schädel. Es ist noch viel zu früh am Morgen für solche tief greifenden philosophischen Überlegungen über Rassismus. Verstohlen blicke ich zur Seite. Seine dunklen Hände ruhen auf dem glänzenden hellgrauen Stoffs seines Anzugs. Der Stoff sieht verführerisch aus; ich möchte ihn gerne berühren. Aber ich hole mich wieder auf den Teppich. Ich möchte die dunklen Schenkel darunter mindestens ebenso streicheln wie diesen glänzenden Stoff. Ach, Scheiße! Warum kann ich jetzt nicht schlafen, statt hier zu sein, mitten in einem Gebiet voller Tretminen für political correctness? Wenn sein Lächeln auf dem Flughafen vorhin wenigstens für mich bestimmt gewesen wäre, nicht für mein Schild, dann wäre mir jetzt leichter zumute. Dann wüsste ich, auch ihm gefällt etwas an mir, und ich könnte offener reagieren.
Zum Glück sind wir nun auf der Autobahn, da muss ich mich konzentrieren und Brown wird es mir sicher nicht übel nehmen, wenn ich die englische Konversation nicht fortführe. Ich habe ohnehin schon gemerkt, ganz so gut, wie ich dachte, ist mein Englisch nicht. Immer wieder fehlen mir die Worte, ich muss umschreiben, verhaspele mich. Wobei er regelmäßig treffsicher zu ahnen scheint, was ich sagen will – und mir mit der richtigen Vokabel aushilft. Eigentlich war es ganz angenehm, mit ihm zu plaudern, aber es bringt mich so durcheinander. Etwa auf halber Strecke bittet er mich ganz überraschend, auf den nächsten Parkplatz zu fahren. Wird das jetzt eine Pinkelpause oder was? Hat er eine schwache Blase? Nun, er ist der Gast, ich bin nur der Chauffeur, und ich tue selbstverständlich, was er sagt. „Was ist los?„, fragt er mich, als ich angehalten habe. Er steigt nicht aus, es geht wohl nicht ums Pinkeln; er will einfach nur wissen, weshalb ich so komisch bin zu ihm. Er ist empfindsam genug, meine innere Zerrissenheit zu spüren, meine kühle Distanziertheit für merkwürdig zu halten. Das spricht für ihn. Da hat er es verdient, eine ehrliche Antwort von mir zu hören. Außerdem, noch etwas über eine halbe Stunde im Auto, dann liefere ich ihn bei meinem Chef ab und werde nie wieder etwas von ihm hören und sehen – außer vielleicht wenn ich ihn für den Heimflug zum Flughafen bringen muss -, da macht es auch nichts, wenn ich mich jetzt tierisch blamiere mit dem, was ich nun sagen werde.
Stockend und auf Englisch versuche ich es ihm zu erklären. Dass er mir sehr gefällt, ich aber nicht weiß, ob ich ihm das zeigen darf, weil er ja schließlich auf die Idee kommen könnte, es sei nur, weil er Schwarz ist. Pardon, Afroamerikaner. Immer schön politisch korrekt bleiben. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass er anfängt zu lachen. Bestimmt hält er mich jetzt für eine ganz blöde Kuh. Genau das sage ich ihm nun auch auf den Kopf zu und drehe mich dabei zu ihm, sehe ihm direkt ins Gesicht. Nein, er wirkt nicht amüsiert, ganz ernst sind sie, diese Augen wie schwarzes Feuer, die irgendetwas in mir zum Flattern bringen. Ebenso ernsthaft erwidert er nur, er halte mich nicht für eine blöde Kuh, sondern für einen sensiblen Menschen, der sich einfach Gedanken macht, wie das eigene Verhalten bei anderen ankommt und verhindern will, jemanden zu verletzen.
Nun bin ich diejenige, die anfängt zu lachen, und er stimmt nach kurzem Zögern mit ein. Ich bemerke zu ihm, dass er eine wirklich nette Art hat, meinen merkwürdigen Zwiespalt zu beschreiben. Impulsiv lege ich ihm die Hand auf den Arm. Es fühlt sich gut an. Der Rest der Fahrt ist nicht nur unproblematisch, sondern sogar schön. Wir unterhalten uns, ganz ungezwungen, als ob wir uns schon ewig kennen würden. Mein Englisch wird mit der Übung immer besser, und am Schluss nennen wir uns beim Vornamen. Wobei er meinen – Anne – Englisch ausspricht. Es gefällt mir. Viel zu schnell sind wir am Ziel angekommen, und jetzt bedauere ich, dass es so weit ist, obwohl ich mir die ganze Zeit diesen Moment sehr erlösend vorgestellt hatte. Mein Chef beachtet mich zuerst gar nicht, als wir klingeln, begrüßt nur Robert. Ich verabschiede mich hastig, bin schon am Gehen, da ruft er mir noch hinterher, er erwarte mich heute Abend um acht zur kleinen Begrüßungsfeier. Na toll! Eigentlich dachte ich, ich hätte ein freies Wochenende! Aber so kann ich dann immerhin Robert wiedersehen. Das hat ja auch etwas. Doch, wenn ich ehrlich bin, ich freue mich auf den Abend. Und so erwische ich mich dabei, dass ich fröhlich vor mich hin summe, als ich wieder ins Auto einsteige.
+++ Fortsetzung folgt +++